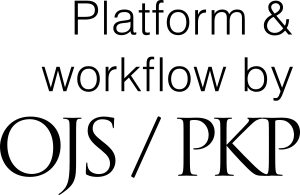Nächste Ausgabe
1/2026: Kein Spiel. Wargaming und Serious Gaming im Zeitalter der KI
Kann Krieg spielerisch erlernt werden? Ist es ethisch vertretbar, die Bekämpfung gegnerischer Einheiten in einem Gaming-Szenario zu trainieren? Birgt die Darstellung realitätsnaher Trainings als ›spielerische Simulation‹ die Gefahr, die kategoriale Unterscheidung zwischen simulierten Szenarien und realen Konflikten zu verwischen?
Diese Fragen sind nicht bloß theoretischer Natur, sondern spiegeln eine bereits existierende Praxis wider. Weltweit setzen militärische und zivile Organisationen zunehmend auf Game-based Learning und Serious Gaming, um komplexe und kritische Fähigkeiten zu schulen, ohne dabei reale Risiken einzugehen. Diese Entwicklung wirft ethische Fragen auf, die friedenspolitische, militärische, technologische und zivilgesellschaftliche Aspekte gleichermaßen betreffen und einer interdisziplinären Auseinandersetzung bedürfen.
Die Beiträge des Themenheftes können auf technikethische Überlegungen zur moralischen Qualität ebenso wie auf den epistemologischen, phänomenologischen oder ontologischen Status solcher Simulationen fokussieren. Gleichermaßen sind militär- und friedensethische sowie zivilgesellschaftliche Überlegungen zur möglichen Vermischung von Realität und Simulation ausdrücklich willkommen. Wir begrüßen interdisziplinäre, empirische Studien sowie Beiträge aus der militärischen Praxis, der Spielebranche und der Games-Forschung.
Redaktion: Kathrin Bruder, Lukas Johrendt, Gerhard Schreiber

2/2026: Potenziale und Grenzen des Pazifismus in Geschichte und Gegenwart
›Nie wieder Krieg!‹ - Diese pazifistische Forderung findet sich immer wieder auch im christlichen Diskurs um Krieg und Frieden. Gerade angesichts der gegenwärtigen vielfältigen bewaffneten Konflikte stellt sich die Frage nach den Möglichkeiten pazifistischer Überzeugungen und gewaltloser Konfliktlösungsstrategien mit neuer Dringlichkeit; man denke nur an die Ukraine oder den Nahen Osten.
Der Band möchte daher inhaltlich zum einen Pazifismus in seinen Ursprüngen untersuchen und zum anderen nach der Relevanz des Konzepts für die Gegenwart fragen. Dabei werden insbesondere auch Herausforderungen, Chancen und Grenzen der zivilen Konfliktbearbeitung in der Gegenwart in den Blick kommen.
Diese Ausgabe zum Pazifismus verfolgt ein doppeltes Ziel: Zum einen soll das Feld des Pazifismus inhaltlich weiter ökumenisch und interdisziplinär erschlossen werden, zum anderen kann so die Vernetzung von Wissenschaftler:innen und Friedenspraktiker:innen weiter gestärkt werden. Hierzu bietet der Pazifismus das ideale Themengebiet. Denn pazifistische Grundüberzeugungen können einen der Motivatoren für ein entsprechendes Engagement in der Friedensarbeit oder der zivilen Konfliktbearbeitung darstellen.
Redaktion: Benedikt Brunner, Gabriel Rolfes, Sarah Jäger.

![]() Schreiben für ethikundgesellschaft
Schreiben für ethikundgesellschaft